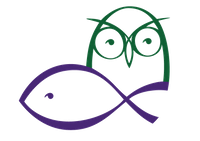Evangelischer Bildungsimpuls 8
Gottesdienst und Kirche
von Dorothea Zager und Werner Zager
Auf seinem Weg zum Gottesdienst kann ein Kirchgänger so mancherlei Entdeckungen machen; Beobachtungen, die ihn nachdenklich und fast wehmütig stimmen: Während er oder sie die Schritte dahin lenkt, wohin das Geläut der Glocken ruft, sind die Nachbarn mit weit anderen Dingen beschäftigt. Da rüstet ein Familienvater das Auto zum sonntäglichen Picknick. Dort kontrolliert ein anderer, angetan mit bunter und technisch-ausgefeilter Radlerkluft, nochmals die Funktionen seines Fahrrades für die Tagestour ins nahegelegene Erholungsgebiet, hier und da begegnet ihm ein Nachbar auf dem morgendlichen Rundgang mit seinem vierbeinigen Freund. Meist aber sieht er stille Gärten, heruntergelassene Läden, verschlossene Türen. Für die Menschen, die dahinter leben, heißt Sonntag zuallererst einmal richtig ausschlafen und in aller Ruhe frühstücken.
Da klingt bei manchem Schritt zum Gottesdienst die Frage mit: Was ist geschehen? Warum gehen sie alle nicht mehr mit? Ja, weiter gefragt: Warum gehe ich selbst eigentlich noch hin?
„Man kann ein guter Christ werden und sein, ohne in die Kirche zu gehen! [...] Das ist ein grundfalscher Satz; wer ihn ausspricht, der weiß gar nicht, was wahres Christentum ist. Er meint, es sei, so einige Sätze für wahr zu halten, ihnen zuzustimmen, aber das Christentum ist inneres Leben! Und dieses Leben entwickelt sich nur, wenn man allsonntäglich aufs Neue in der christlichen Gemeinde sich versammelt und allsonntäglich Gottes Wort hört.“
„Da hört man das berühmte Wort: Das Kirchengehen ist eine Gewohnheit, etwas Äußerliches. Gewiss, aber es ist eine notwendige, eine gute und eine schöne Gewohnheit, ohne die man nicht Christ werden kann. Ich sage es noch einmal: In unserer Zeit, wenn einer sich nicht zur Kirche hält, wenn er sich nicht am Sonntag in der Kirche erbaut, so kann er in seinem Christentum nicht wachsen, es wird nicht eine Kraft, die sein ganzes Leben durchzieht, sondern es bleibt etwas Äußerliches, eine Erinnerung, ein Name.“
„Man sagt: In die Kirche soll man gehen, wenn man von einem inneren Bedürfnis getrieben wird; aber dieser Satz ist falsch, wenn man nicht dazusetzt, dass man das innere Bedürfnis erst dann kennenlernt, wenn man allsonntäglich in die Kirche kommt. Man muss mit der Gewöhnung anfangen!“
Fast hat man den Eindruck, Schweitzer habe unsere heutigen Schwierigkeiten damals schon gekannt. Er schreibt, als wäre ihm diese stille Sonntagsidylle, die uns so schmerzlich das Desinteresse bewusst macht, das so viele unserer Mitmenschen der Kirche und dem Gottesdienst entgegenbringen, – als wäre ihm diese stille Abkehr von der Kirche schon vor über 100 Jahren vertraut gewesen. Und sie schmerzte auch ihn.
Es ist ja nicht so, dass die Menschen den Sonntag entheiligten, indem sie ihn zum Tag machten wie jeden anderen, ihn anfüllten mit Arbeit, Termindruck und alltäglicher Mühe. Vielmehr ist der Sonntag noch immer, ja immer mehr zu dem Tag der freien Zeit schlechthin geworden. Zu einem Tag, an dem eben nicht die Arbeit, sondern die Freizeit im Vordergrund steht. Freizeit aber heißt heute oftmals nicht mehr Sammlung am Sonntag, sondern Zerstreuung am Wochenende.
Das hat Schweitzer gewiss nicht gemeint, als er das Schlagwort „Religion ist Privatsache“ zu einem seiner liebsten Worte erklärte. So sehr Schweitzer dem einzelnen Menschen Mut machte zum selbstständigen Denken und zur persönlichen, ja ganz individuell gefassten Frömmigkeit, so wusste auch er, dass es ein Band geben muss, das uns innerlich – so unterschiedlich wir auch sein mögen – miteinander verbindet: Dieses Miteinander-Verbundensein kommt und lebt aus der sonntäglichen Gemeinschaft im Gottesdienst.
Die Frage: Warum gehe ich (noch) in die Kirche? beantwortet Schweitzer in einem Dreiklang wegweisender Gedanken:
Das Zeichen der inneren Bindung
Der Gang zum Gottesdienst ist ein Zeichen dafür, dass wir die Kirche liebhaben.
„Meinen Konfirmanden habe ich immer gesagt: Behaltet die Kirche lieb. Sie ist nicht das, was sie sein sollte. Aber sie hat auch die Kunde vom Evangelium bewahrt, die Worte Jesu, die des Apostels Paulus und sie ruft auch am Sonntag zur Besinnung in der Stille.“
Christ oder Nichtchrist, das ist heute äußerlich kaum noch zu erkennen. Der ‚Fisch am Auto‘ verrät aber, dass ein Wunsch durchaus vorhanden zu sein scheint, sich offen dazu zu bekennen, Christ zu sein. Der Weg zum Gottesdienst kann ein solches Zeichen des Bekennens sein: Ich gehöre dazu. Ich schätze meine Kirche und halte ihr die Treue, wenn mir auch nicht alles an ihr gefällt.
Der Ort der Stille
Der normale Arbeitsalltag, der dem vielbeschäftigten Menschen an körperlicher Anstrengung, geistiger und seelischer Kraft oft mehr abverlangt, als er aufbringen kann, braucht eine Unterbrechung – eine Gelegenheit für den Menschen, an Leib und Seele wieder zu Kräften zu kommen. Das kann nicht nur der jährliche Urlaub sein, dem die gesamte Arbeitswelt Jahr für Jahr sehnsüchtig entgegenstrebt. Nicht eine Unterbrechung, die den Menschen für zwei oder drei Wochen aus der anstrengenden Wirklichkeit in eine arbeitsfreie Traumwelt entführt, sondern ein Innehalten, das inmitten des Alltags einen Ort schafft, wo wir uns auf das besinnen, wovon unser Leben Orientierung und Halt empfängt – eben gerade auch unser Leben im alltäglichen Getriebe. Das kann und will Gottesdienst sein:
Hier kann der Mensch zur Ruhe kommen, zu sich selbst finden und sein Leben ausrichten an den beiden Polen christlicher Botschaft, die unser Leben frei machen und mit Sinn erfüllen will: die Zusage der Gottesliebe, wie sie uns in Jesus begegnet ist, und der Ruf in seine Nachfolge.
„Aus den Gottesdiensten, an denen ich als Kind teilnahm, habe ich den Sinn für das Feierliche und das Bedürfnis nach Stille und Sammlung mit ins Leben genommen, ohne die ich mir mein Dasein nicht denken kann. Darum vermag ich der Meinung derer nicht beizutreten, die die Jugend am Gottesdienste der Erwachsenen nicht teilnehmen lassen wollen, ehe sie etwas davon versteht. Es kommt gar nicht auf ein Verstehen an, sondern auf das Erleben des Feierlichen. Dass das Kind die Erwachsenen andächtig sieht und von ihrer Andacht mit ergriffen wird: dies ist es, was für es bedeutungsvoll ist.“
Das Vorbild für die kommende Generation
An dieser Schilderung aus Schweitzers Kindheitserinnerung ist – genauso wie aus seinem eben angeführten Wort an die Konfirmanden – zu erkennen, wie hoch Schweitzer die Bedeutung der Jugend und der Kinder für die Zukunft unserer Kirche einschätzt:
„Was in unsern Gottesdiensten fehlt, das ist die Jugend. Woran liegt das? An unsern Konfirmanden selbst? Nicht so sehr. Denn am Konfirmationstag nimmt sich doch jedes vor, die Kirche nicht zu verlassen. An den Eltern liegt die Hauptschuld, dass sie ihre Kinder nicht zum Kirchgang anhalten. [...] Sie halten daran, dass ihre Kinder christlich erzogen werden, sonst hätten sie sie nicht in den Konfirmandenunterricht geschickt. Das wollen wir bei den meisten annehmen. Und nun meinen sie, ihre Kinder könnten rechte Christen werden, wenn sie auch nicht in die Kirche gehen.“
Wie für die Entwicklung des Kindes und Jugendlichen überhaupt, so ist auch für die religiöse Einstellung das Vorbild der eigenen Eltern von entscheidender Bedeutung. Ein Sonntag, der mit einem festlichen, möglichst gemeinsamen Frühstück beginnt, dessen Vormittag wie selbstverständlich gefüllt ist mit dem gemeinschaftlichen Gang zur Kirche, weil auch für die Eltern der Gottesdienstbesuch ein innerlich notwendiges Bedürfnis ist, der dann manchmal sogar ausklingt in einem Gespräch über das Gehörte und im Gottesdienst Erlebte, solch ein Sonntag ist ein Geschenk. Er schenkt nicht nur den Kindern die tiefe Erfahrung der Zugehörigkeit zur Kirche, sondern auch das unauslöschliche Gespür für die Schönheit und den tiefen Gehalt des dritten Gebotes für Mensch, Welt und Kreatur: ‚Du sollst den Feiertag heiligen.‘
Der sonntägliche Gottesdienst ist nicht eine Pflichtübung, sondern ein Angebot, sich Stille, Gemeinschaft und neue Lebenskraft schenken zu lassen.
Angefügt sei noch ein äußerst befreiender Gedanke für all’ diejenigen, deren Wege sich beim Kirchgang vielleicht trennen müssen, weil der eine zur katholischen, der andere zur evangelischen Kirche geht, und für all’ diejenigen, die sich schon lange fragen, warum der Dialog zwischen den christlichen Kirchen noch immer so schleppend vorangeht. Schweitzer hat hier eine Stellung eingenommen, die von Realitätssinn und Toleranz gleichermaßen zeugt und die uns ermutigt, auch mit Andersglaubenden eine Einigkeit im Geist zu suchen, selbst wenn konfessionelle Grenzen noch zwischen uns stehen:
„Von je her habe ich mich nicht in besonderer Weise für die Einigung christlicher Kirchen interessiert. Jede hat ihre besondere Eigenart, jede ihre Berechtigung. Was sie einigen soll, ist das Streben, den Geist Christi zu haben. Wenn dieses Streben sie leitet und anspornt, sind sie geistig geeint, was für sie und die Welt viel mehr bedeutet als eine Vereinigung auf Grund von Vereinbarungen, die immer Flickwerk bleiben wird.“
© Prof. Dr. Werner und Dorothea Zager
Abdruck oder Veröffentlichung nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verfassers
Sie können den Bildungsimpuls zur besseren Lesbarkeit auch hier downloaden und ausdrucken.