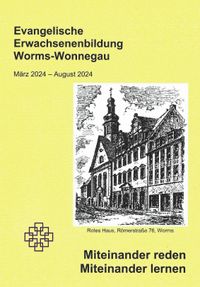G wie Glaubensbekenntnis
Von A bis Z. Wegweisende Texte 10
Glaubensbekenntnis
Liebe Leserin, lieber Leser,
nicht wenige Christenmenschen heutzutage haben ihre liebe Not mit dem Apostolischen Glaubensbekenntnis, wie es üblicherweise bei uns im Gottesdienst gesprochen wird. Als ein im 5. Jahrhundert entstandener Text enthält das Apostolikum eine Reihe von Vorstellungen, die wir uns als aufgeklärte Menschen nicht mehr ohne Weiteres aneignen können.
Dies zeigt auch sehr klar der Aufsatz von Pfarrer Ulrich Finckh (1927–2019), der übrigens einmal zu Beginn seiner Dienstzeit Pfarrer in Mettenheim war, bevor er nach Hamburg und später nach Bremen ging. An der einen oder anderen Stelle kann der Autor nicht verleugnen, dass er mehr als drei Jahrzehnte Vorsitzender der Zentralstelle für Recht und Schutz der Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen war. Auch wenn ich selbst die Dinge hier etwas anders beurteile, halte ich die Anfragen Fincks gegenüber dem Credo für berechtigt und nachdenkenswert.
Glücklicherweise sind wir in unseren Kirchengemeinden nicht verpflichtet, in jedem Gottesdienst das Apostolische Glaubensbekenntnis miteinander zu sprechen. Wir haben auch die Möglichkeit, ein Glaubensbekenntnis aus neuerer Zeit zu wählen.
Ein solches Glaubensbekenntnis ist das Ringstedter Glaubensbekenntnis (hervorgegangen aus einem Gesprächskreis Ende der 1980er-Jahre), das sich nach meiner eigenen Erfahrung in vielen Situationen bewährt hat. Es lautet:
Wir glauben an Gott, den ewigen Schöpfer: Weil Gott die Menschen geschaffen hat und sie liebt, haben sie eine unantastbare Würde. In Gottes Schöpfung gibt es nichts, was ohne Wert wäre und deshalb vernichtet und verdorben werden darf. Dieser Glaube bewahrt uns davor, irdische Mächte an die Stelle Gottes zu setzen.
Wir glauben an Jesus Christus, der uns zur Nachfolge einlädt: In ihm hat Gottes Liebe und seine Barmherzigkeit menschliche Gestalt angenommen. Er brachte den Bedrückten Entlastung. Er bestätigte den Entrechteten das ihnen von Gott gewährt Recht. Er zeigte den Ungeliebten und Abgelehnten Liebe. Sein Tod war nicht das Ende, sondern ein neuer Anfang. Gott hat Jesu Weg bestätigt, denn auch in der tiefsten Verzweiflung erfuhren die Jünger neue Zuversicht, ja Begeisterung.
Wir glauben an Gott, den lebensstiftenden Geist in unseren Herzen: Durch seinen Geist ist er in allen Höhen und Tiefen immer bei uns. Das tröstet uns in unseren Ängsten. Zu Beginn stiftet die Taufe ein unlösbares Band zwischen ihm und den Menschen. Im Abendmahl erleben wir immer wieder die Feier der gegenwärtigen Gottesliebe.
Der Glaube an Gottes heilendes Wirken in der Welt gibt uns die Kraft, Botschafter der Hoffnung gegen alle Bedrohungen des Lebens zu sein.
Gegen den Zweifel und die Angst setzen wir die Vision einer versöhnten Welt ohne sinnloses Leiden, Naturzerstörung und Krieg. Für die Erneuerung und Verwandlung der Welt treten wir vor Gott mit unserem Gebet und vor den Menschen mit unserem Tun ein. Amen.
Die ältesten christlichen Bekenntnisse sind Antworten auf die Osterbotschaft von der Auferweckung Jesu. Darum ist Ostern ein guter Anlass, über den Glauben nachzudenken; denn zum Glauben gehört das Verstehen hinzu. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein frohes und hoffnungsvolles Osterfest.
Es grüßt Sie freundlich
Ihr Werner Zager
Credo – eine Anfrage
Glaubensbekenntnisse vergangener Zeiten können zu einer anderen Zeit und Situation irreführend sein – meint Ulrich Finckh. Heute gibt es zwar eine verbreitete Suche nach modernen Glaubensbekenntnissen. Das Apostolikum wird aber – nach wie vor – in den meisten Gottesdiensten regelmäßig gesprochen und wohl ebenso regelmäßig missverstanden: Was bekennen wir eigentlich mit diesen Worten?
Von Ulrich FinckhDass viele Kolleginnen und Kollegen sich beim Sprechen des Apostolikums unwohl fühlen, merkt man an den üblichen gewundenen Einleitungen wie „bekennen wir mit den Worten unserer Väter“, „... mit der ganzen Christenheit“ oder „sprechen wir gemeinsam das alte Glaubensbekenntnis“. Solche Formulierungen ändern aber nichts daran, dass das Apostolikum als „Bekenntnis“ gesprochen wird, nicht zuletzt ohne solche Kautelen bei allen Taufen. Ich meine, wir sollten darüber ernsthaft kritisch diskutieren, denn es wird nur noch missverstanden, und das nicht nur im SPIEGEL.
Um die Diskussion gleich anzufangen: Was heißt es, Gott „Vater“ zu nennen? In der antiken Welt mit den vielen Göttersöhnen von den berühmten Stadtgründern (z.B. Theseus und Romulus) über Dionysos und Herakles bis zu den römischen und anderen Kaisern war dieses Bekenntnis eine Kampfansage an die vielen Gottheiten und die Betonung, dass Jesus allein zu verehren ist. Dem entspricht, dass nur der Gott, den er verkündet hat, als Vater und Allmächtiger angesprochen wird. Aber weiter: Wie können wir nach Auschwitz von Gott als dem „Allmächtigen“ reden? Die Aussage war angemessen in einer Welt, in der es die zahllosen Götter gab, die je nach ihrer Zuständigkeit unterschiedliche Verehrung und unterschiedliches Verhalten in ihrem Bereich forderten. Für Christen gab und gibt es aber nur eine einheitliche Verantwortung im ganzen Leben. Interessant ist, nicht deistisch von Gott zu reden [d.h. Gott oder das Göttliche als Ursprung von allem, ohne in die Geschichte einzugreifen; W.Z.], ihn gleichsam von außen zu betrachten. Es geht um unser Leben und seine Ausrichtung. Heute müssten wir sagen, dass Liebe und Mitmenschlichkeit in allen Lebensbereichen gelten und die angeblichen Eigengesetzlichkeiten von Wirtschaft und Politik, Kunst und Technik, Liebe und Krieg etc. nicht von der Verantwortung vor den Mitmenschen entbinden dürfen. Aber wer entmythologisiert das, wenn einfach die alten Formeln gesagt und als Bekenntnis bezeichnet werden?
„Schöpfer des Himmels und der Erde“ – eine Steilvorlage für Kreationisten [Menschen, die die biblischen Schöpfungsberichte buchstäblich für wahr halten; W.Z.]. Was gegenüber den gnostischen [das griechische Wort „Gnosis“ bezeichnet religiöses Wissen; W.Z.] Vorstellungen von einem guten Himmelsgott und einer irdischen Gefangenschaft der Seele sinnvoll war, ist gegenüber der modernen Naturwissenschaft sinnlos geworden. In den biblischen Schöpfungsgeschichten geht es um die Stellung des Menschen gegenüber der Welt und den Mitgeschöpfen, um Sinn und Auftrag des Lebens, um das Ernstnehmen unserer Begrenztheit, aber nicht um naturwissenschaftliche Lehren. Schon die Gegensätze zwischen Gen. 1 und 2 [Genesis = 1. Buch Mose; W.Z.] machen das deutlich, aber im Apostolikum wird das nicht erkennbar. Dass im ersten Artikel dann nichts über die Geschichte Israels, über die Wandlungen der Gotteserkenntnis, über Mose und die Propheten und deren Bedeutung für die Botschaft Jesu gesagt wird, ist ein zusätzliches Problem.
Nicht besser steht es um den zweiten Artikel. „Jesus Christus“ wird als Name wie „Hans Müller“ verstanden. Dass „Christus“ ein Königstitel ist, dass schon in der hebräischen Bibel der König als Gottes Sohn bezeichnet werden konnte – wer hört das noch heraus? Gottes eingeborener Sohn – ein zweiter Gott (wie es uns die Muslime vorhalten)? Oder als der „eingeborene“ eine Gegenaussage zu den göttlichen Kaisern und all den vielen antiken Göttersöhnen? Das Apostolikum entscheidet sich für eine mythologische Überhöhung durch die Legenden von Matthäus und Lukas, so widersprüchlich sie auch sind, mit der Erwähnung der Jungfrau Maria. Die Adoption zum Gottessohn bei Markus und die ewige Göttlichkeit bei Johannes sind damit auf die Seite geschoben. Aber was soll eine solche Aussage wie die Jungfrauengeburt? Jesus als nicht-eheliches Kind ist in unserer Welt kein Beleg seiner Bedeutung und auch nicht brauchbar als der einst wichtige Hinweis, dass der Gottessohn ganz Mensch war. Dass selbst bei Matthäus und Lukas die Jungfrauengeburt nicht durchgehend vorausgesetzt wird, verschwindet in der Bekenntnisaussage, die die genaue Bibellektüre übergeht und erst recht die historisch-kritische Analyse der Texte unbeachtet lassen muss, weil es die damals nicht gab. Dass dann das gesamte Wirken Jesu übergangen wird, ist mehr als misslich. Wie soll man an ihn glauben und ihm nachfolgen, wenn man nichts von ihm weiß?
Gut ist eigentlich, dass mit dem Hinweis auf Folter und Hinrichtung der Gegensatz zu Pilatus, dem römischen Generalgouverneur, festgehalten wird. Aber wer versteht das noch als Kampfansage an Militär, Besatzung und kriegerische Gewalt? Seit dem Arrangement mit Konstantin auf der Synode von Arles betete die Christenheit für den Kaiser, auch wenn das ein gewalttätiger Kriegsfürst war, der selbst in der eigenen Familie wütete, und seitdem für jegliche Obrigkeit. Dazu haben wir seit Augustinus die Lehre vom gerechten Krieg, der heute gerechter Friede heißt (aber immer noch nicht auf die ultima ratio Krieg verzichtet). Dieser erste Teil des zweiten Artikels ist also zumindest missverständlich und wird in der Praxis nicht beachtet. Danach wird der zweite Artikel ganz und gar mythologisch. Natürlich ist es eine gute Überlegung, dass die Menschen, die vor Jesus gelebt haben, nicht einfach abgeschrieben sind. Aber kann man das mit dem Abstieg ins Totenreich deutlich machen? Und den Sieg über den Tod zum Negieren des Kreuzes werden lassen? Warum sind die Auferstehungsberichte so widersprüchlich? Warum weiß Paulus noch nichts vom leeren Grab? Wie kann man mit den mythologischen Aussagen deutlich machen, dass letztlich nicht die militärische Macht des Römischen Reiches, sondern die Mitmenschlichkeit, Gewaltlosigkeit und Leidensbereitschaft Jesu allein den rechten Weg zeigt? Indem man einfach Auferstehung „bekennt“?
Und was besagt im Zeitalter der Weltraumfahrt die Himmelfahrt? Und das Sitzen zur Rechten Gottes (nochmals mit dem Hinweis auf den allmächtigen Vater)? Die Erwartung des Gerichts? Diese Bilder sind heute nur noch missverständlich, auch wenn sie ahnen lassen, dass es um Rechenschaft über unser Leben geht. Wie können wir unser Tun und Lassen vor Gott und Menschen verantworten? Dass wir dabei auf Verständnis, Vergebung, Rechtfertigung angewiesen sind, kommt nicht vor. Dass heute ganz allgemein mit einem Gericht nicht mehr gerechnet wird, ergibt sich aus der Beobachtung, die wir als Pfarrer oft genug gemacht haben: Wovor sorgen sich die Menschen, wenn sie an den Tod denken? Vor dem Gericht danach? Nein, vor den Schmerzen davor. Wie oft habe ich gehört „am liebsten möchte ich mal tot umfallen oder im Schlaf vollends einschlafen“. Wenn jemand todkrank im Krankenhaus liegt, werden von den Ärzten oft selbst die nächsten Angehörigen ferngehalten, damit Patienten sich nicht aufregen. Dass bei Schmerzen die Schmerzmittel so dosiert werden, dass die Sterbenden gar nicht mehr recht bei Bewusstsein sind, ist auch ganz selbstverständlich. Und wenn man als Pfarrer fragt, ob man einen Schwerkranken besuchen soll, wird nur zu oft abgewunken, weil er dann ja denken könnte, dass er sterben muss. Unter Gericht und Verantwortung stellen wir uns alles Mögliche vor, nur nicht, dass Jesus kommt und die Menschheit vor ihm antreten muss, so dass wir uns darauf vorzubereiten haben, solange es noch Zeit ist. Was „bekennen“ wir dann mit der Ansage von Wiederkunft und Gericht im Apostolikum?
Auch der dritte Artikel hat seine Probleme. Was der Hinweis auf den Heiligen Geist meint, kann man immer wieder in Predigten erklären, und trotzdem wird es nur zu oft missverstanden. Dass die Kirche als „Gemeinde der Heiligen“ bezeichnet wird, ist dogmatisch sinnvoll, wird aber im Blick auf die Kirchengeschichte vom normalen Mitbürger unter Hochstapelei verbucht. Da hilft auch nicht der zu Recht gleich folgende Hinweis auf die Vergebung der Sünden, der nur zu leicht gemäß Voltaire missverstanden wird: „Er wird mir schon vergeben, das ist ja sein Metier“. Und dann vollends wieder die mythologischen Sätze von der Auferstehung der Toten und dem ewigen Leben. Was wird da „bekannt“? Ein Weltbild von vor 2000 Jahren? Oder die Nachfolge Jesu, weil wir seinen Weg als den allein selig machenden verstehen?
Mit den anderen altchristlichen Bekenntnissen steht es nicht anders. Die Mühen, die es machte, von der jüdisch geprägten dynamischen Sprache in die objektivierende Sprache der hellenistischen Welt zu übersetzen, können wir als Theologen verstehen und deshalb auch die widersprüchlichen Aussagen wie „ganz Gott – ganz Mensch“ als sinnvollen Teil dieser Übersetzung. Aber was einstmals als Ergebnis dieser Mühe formuliert wurde, war zeitbedingt. Heute haben wir es wieder mit einer ganz anderen Sprache zu tun, die von historischer Kritik und naturwissenschaftlichem Denken geprägt ist. Da müssen wir versuchen, die Missverständnisse zu vermeiden, die entstehen, wenn mythologische Aussagen wie historische gelesen werden. (Was Fundamentalisten ebenso unsinnig tun wie manche unbedarfte Kritiker des christlichen Glaubens.) Wir müssen also wieder übersetzen, diesmal in Kategorien wie Lieben und Hoffen, Vertrauen und Vergeben, in Aussagen über Sinn, Gabe und Aufgabe des Lebens. Dann kommen zwar die Fundamentalisten und beschweren sich, man würde ja nur Ethik verkünden, also Gesetz. Über Liebe und Rechtfertigung kann man aber erst angemessen reden, wenn man auch danach fragt, was sein soll, was gut und böse ist. Dogmatisch geht es dabei um das Thema Gesetz und Evangelium, und das will in unser Leben übersetzt sein, um in die Nachfolge des Gekreuzigten rufen zu können und in die Freiheit, die er gelebt und verkündet hat.
Aus: Deutsches Pfarrerblatt 12/2007, S. 663-664.
Hier finden Sie den Text als PDF zum Downloaden und Ausdrucken.