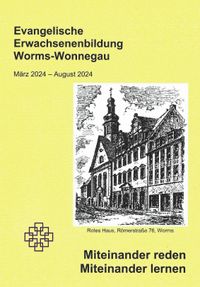M wie Modernisierung
Von A bis Z. Wegweisende Texte 15
Modernisierung
Liebe Leserin, lieber Leser,
jede Zeit hat ihre besonderen vorherrschenden Begriffe, die sich mit einer Ideologie verbinden können. Dies macht der Artikel von Jan Ross deutlich anhand des vor zwanzig Jahren allseits verwendeten Modebegriffs der „Modernisierung“.
Kennt auch unsere Zeit einen solchen Modebegriff? Ich persönlich halte den Begriff „Digitalisierung“ für einen solchen. Problematisch dabei ist nicht die damit bezeichnete Technik, sondern der häufig damit verbundene Glaube, damit könnten alle Probleme der Menschheit gelöst werden.
Gerade in den Zeiten der Pandemie hat es sich gezeigt, wie wichtig es ist, dass unsere Schulen über die nötige digitale Ausstattung verfügen. Jedoch allein dadurch wird noch nicht der Lernerfolg verbürgt.
Vielmehr kommt es darauf an, Lust und Interesse für die großen und kleinen Fragen unseres Lebens bei den jungen Menschen zu wecken, sie zu beteiligen an der Erkundung unserer Welt, mit ihnen gemeinsam über Sinn und Auftrag unserer menschlichen Existenz nachzudenken.
Dies ist allerdings nicht nur Aufgabe der Schule, sondern von uns allen – sei es als Eltern, Verwandte, Nachbarn und Freunde, sei es in einer Kirchengemeinde oder in einem Verein. Gerade die Kirche bietet ein Forum, wo Menschen verschiedener Generationen in einem offenen und wertschätzenden Dialog miteinander ins Gespräch kommen können über die Fragen, die uns heute umtreiben. Dies ist eine große Chance, die es zu nutzen gilt – nicht zuletzt vonseiten der Evangelischen Erwachsenenbildung.
Es grüßt Sie freundlich
Ihr Werner Zager
Ein neuer Glaube
„Modernisierung“ ist ein Modebegriff, kein Wert an sich
Von Jan Ross
Dreiundzwanzigmal, wenn kein Fehler beim Zählen passiert ist, fallen im Schröder-Blair-Papier über die Zukunft der Sozialdemokratie die Stichworte „modern“ oder „Modernisierung“. Das ist in etwa die Frequenz, mit der in den Verlautbarungen anderer Zeiten und Parteien Begriffe wie „Vaterland“ oder „Proletariat“ aufzutauchen pflegten. Früher hätte man ein solches Formelwesen als Ausdruck von Ideologie gedeutet. Zumal es sich ja keineswegs um ein Sondervokabular der Neuen Mitte handelt, wo diese Gebetsmühle freilich besonders fleißig gedreht wird. Die Modernisierungsrhetorik ist vielmehr der halb amtliche politische Jargon der gesamten Bundesrepublik. Ob es um das Steuersystem geht, um die Renten, das Gesundheitswesen, das Staatsbürgerschaftsrecht oder die Bildungspolitik – stets ist klar, dass man die Sache, welche auch immer es gerade sein mag, modernisieren muss. Natürlich herrscht keine Einigkeit darüber, was unter Modernisierung eigentlich zu verstehen sei. Aber das gehört erst recht zum Wesen der Ideologie.
Zur Modernisierung muss man zunächst einmal feststellen, dass sie ein alter Hut ist. „Wir schaffen das moderne Deutschland“, hieß es 1969, unter Willy Brandt, auf den Wahlplakaten der SPD. Der Soziologismus „Modernisierung“ war damals noch nicht so geläufig, man sprach in den sechziger und frühen siebziger Jahren schlicht und einfach von Fortschritt. Als er sich dann vollzogen hatte, stellte man fest, dass er zwar ein paar notwendige Anpassungen von Staat und Recht an eine veränderte gesellschaftliche Realität mit sich gebracht hatte, aber viel Unsinn auch: unwirtliche Großsiedlungen und verkehrsgerecht tote Innenstädte, leistungsschwache und sozial verwahrloste Gesamtschulen, historisch ignorant zusammengeschneiderte Megalandkreise und zerflatternde Familienbande, einen Haufen von Staatsschulden und Berge von Giftmüll. Die diversen Wende-Slogans, die bald zu hören waren, vom konservativen „Mut zur Erziehung“ bis zu den ökologischen „Grenzen des Wachstums“, zielten sämtlich, wenngleich an verschiedenen Stellen, auf die Reparatur von Fortschrittsschäden. Man war der begradigten Flussläufe ebenso überdrüssig geworden wie der kahlen Häuserfassaden, von denen ein vandalenhafter Säuberungseifer den Bauschmuck hatte abschlagen lassen. „Postmoderne“ und „Neokonservativismus“, Umwelt- und Denkmalschutz reagierten auf das verbreitete Unbehagen an gedankenloser Progressivität.
Dass nicht einfach alles immer mehr und immer besser werden würde, dass man sparsam und schonend mit den Ressourcen umgehen muss, mit unseren begrenzten Vorräten an Energie, Natur, Kapital, Tradition und Gemeinsinn – diese Einsicht schien sich für einen Augenblick zumindest theoretisch durchgesetzt zu haben. Unter dem Druck der Modernisierungsparole wird sie nun wieder vergessen, und der Fortschrittsglaube erhebt noch einmal sein bemoostes Haupt.
So ist es keineswegs gemeint, werden jetzt die Modernisierer einwenden. Es geht ja nicht um das Planen, Steuern und Organisieren seligen Angedenkens, nicht um irgendwelche technokratischen Großentwürfe, sondern im Gegenteil um Entbürokratisierung und Deregulierung, um mehr Flexibilität. Aber in Wahrheit ist die neue Modernisierungsideologie nicht weniger gleichmacherisch als der alte Fortschrittsglaube. Sie hat ebenfalls eine standardisierte Zukunftsvision und einen genormten Idealtypus, den sie per Retortenzeugung hervorzubringen sucht. Man kann ihn sich aus all der schlechten Prosa über „Selbstständigkeitskultur“, „lebenslanges Lernen“ oder „Chancenorientierung“ so ungefähr zusammenreimen und hat dann, wie in allen Ideologien, wieder einmal einen „neuen Menschen“ vor sich, diesmal einen Wechselbalg aus Emanzipation und Konkurrenzfähigkeit, unternehmerisch die eigene Existenz bewirtschaftend und auf dem Markt der Lebensangebote ein souveräner Kunde.
Schulen als Servicestationen für den wirtschaftlichen Wettbewerb
Diesen Zombie an die gesellschaftliche Apparatur anzupassen und die gesellschaftliche Apparatur an ihn, das ist der dogmatische Kern der scheinbar so undogmatischen Modernisierung. Weit entfernt davon, Vielfalt zu befördern, ist ihr in Wahrheit eine nivellierende, egalisierende und homogenisierende Tendenz eigen, ein tief sitzendes Ressentiment gegen das Bunte, Unverwechselbare und Eigenwillige. Weil wir in einer Dienstleistungsgesellschaft leben, soll von den Behörden die Dienstleistung Verwaltung angeboten werden, von den Schulen die Dienstleistung Bildung – in beiden Fällen möglichst unter Einsatz von Computern, denn von der Informationsgesellschaft hat man auch schon gehört. Waren den Altreformern Verwaltung und Schule Agenturen zur Umverteilung von Sozialchancen, so sind sie für die Modernisierer Servicebetriebe zur Wettbewerbsbegleitung. Dass eine Schule einfach eine Schule und eine Verwaltung eine Verwaltung sein muss, nicht etwas anderes, sondern in ihrer Art gut, dass man dazu eine Vorstellung vom Staat oder von Bildung, nicht eine von „Moderne“ braucht, das ist den einen so unbekannt, wie es den anderen war. Und so kann man schon jetzt Wetten darauf annehmen, dass morgen der Internet-Anschluss in jedem Klassenzimmer genauso langweilen wird wie gestern der marxistisch inspirierte Gemeinschaftskundelehrer, während die Schlangen vor den katholischen Privatgymnasien lang sind wie eh und je.
Das Blaupausenhafte des Fortschrittsdenkens ist also durchaus nicht verschwunden. Der wirkliche Unterschied zu den siebziger Jahren ist ein anderer. Der „Fortschritt“ war noch eine Kampfparole gegen Konservativismus und Reaktion. „Modernisierung“ dagegen meint nur mehr einen Prozess, der ohnehin abläuft und in den man sich bloß einklinken muss. Die Modernisierungslosung ist daher, wie von einer Wolke, umgeben von einer Schar anderer Schlüsselwörter, die allesamt Alternativlosigkeit und Selbstgängertum suggerieren, Begriffe wie „Pragmatismus“ oder „intelligente Lösungen“, denen sich kein vernünftiger Mensch verschließen kann. Es gibt, so die Botschaft, eigentlich nichts zu erwägen und zu entscheiden, man muss bloß ausführen, was an der Zeit ist. Politik aber hat mit Entscheidungen und Alternativen zu tun, bisweilen mit sehr grundsätzlichen, und wer davon nichts mehr wissen will, der träumt von einer entpolitisierten Welt. Roman Herzog, der erste Modernisierer seines Staates, hat sich in seiner „Berliner Rede“ zum Sprachrohr dieser Mentalität gemacht, mit der klassischen Formulierung, wir hätten kein Erkenntnis-, sondern bloß ein Umsetzungsproblem.
„Modernisierer“ zu sein, das befreit von der Last, eine eigene Position beziehen zu müssen, eigene Kriterien für Richtig und Falsch, für Freund und Feind, womöglich gar für Gut und Böse zu entwickeln und zu vertreten. Das entspricht den Bedürfnissen einer politischen Klasse und vielleicht eines ganzen Jahrhunderts, die schon auf zu viele falsche Pferde gesetzt und sich schon zu oft blamiert haben, als dass sie sich noch ein eigenes Urteil zutrauen würden. Dann wirkt es wie eine Erlösung, wenn man, wie Gerhard Schröder, entdeckt, dass es keine linke oder rechte Wirtschaftspolitik gibt, sondern nur eine moderne und eine unmoderne. Der Modernisierungsglaube verspricht Sicherheit; wie im Marxismus darf man sich als williger Vollstrecker historischer Gesetze fühlen, nur ohne die Fährnisse des Klassenkampfes und ohne das Risiko, dabei auf die Nase zu fallen.
„Modernisierung“ ist aber keine sichere Richtschnur politischen Handelns, sie ist überhaupt kein Wert an sich. Die Nationalsozialisten haben die deutsche Gesellschaft in mehr als einer Hinsicht durchgreifend modernisiert. Sie haben Machtstellung und Rückgrat des Adels gebrochen, die Standesschranken vor dem Eintritt ins Offizierskorps niedergelegt, die herkömmlichen Ordnungen von Familie und Kirche aufgesprengt und die Frauen während des Krieges von Heim und Herd in die Fabriken geholt. Auch die DDR hat beachtliche Modernisierungserfolge aufzuweisen: die endgültige Zerschlagung des notorisch reaktionären ostelbischen Großgrundbesitzes durch die Bodenreform oder die gleichmäßige Beteiligung beider Geschlechter am Erwerbsleben. Als Sowjetunion, unter Stalin, ist Russland ins Industriezeitalter vorgestoßen. Trotzdem sind Nationalsozialismus und Kommunismus unmenschliche Systeme gewesen. Modernität und Freiheit sind nämlich zweierlei. Manchmal ist es sogar so, dass das Unmoderne eine Bastion der Freiheit darstellt. Der polnische Katholizismus und das polnische Kleinbauerntum sind gewiss keine Milieus von vorbildlicher Aufgeklärtheit. Dass sie sich behaupten konnten, während in anderen sozialistischen Ländern der Kirchenkampf die Säkularisierung und der Agrarkollektivismus eine zeitgemäßere Landbewirtschaftung voranbrachten, mag aus der Modernisierungsperspektive als rückständig erscheinen. Man sieht es nicht zuletzt daran, welche Schwierigkeiten die Bauern und manche Teile des Klerus gegenwärtig mit Polens Öffnung zur Europäischen Union haben. Aber diese Bollwerke der „Rückständigkeit“ waren wesentlich mitverantwortlich dafür, dass der Kommunismus sich die polnische Nation nie wirklich unterwerfen konnte. Die Beharrungskräfte des Landes haben nicht weniger als die liberale städtische Intelligenz oder die Aufmüpfigkeit der Arbeiterschaft zu jener zähen „zivilgesellschaftlichen“ Resistenz beigetragen, an der sich die Staatsmacht die Zähne ausgebissen hat. In der „modernen“, traditionsschwachen DDR dagegen saßen die Herrscher so fest im Sattel wie nirgendwo sonst.
Kritiklosigkeit ist die eine Gefahr im Umgang mit der Modernisierung. Die andere ist Überschätzung. Auch säkulare Veränderungsprozesse reichen nicht überallhin. Außenpolitik zum Beispiel mag klug oder töricht sein, auch segensreich oder verbrecherisch, aber eben nicht, im Sinne von Gerhard Schröders wirtschaftspolitischer Erleuchtung, modern oder unmodern. Was über Mächte und Imperien zu sagen ist, kann man noch immer bei Thukydides im Peloponnesischen Krieg nachlesen, übrigens auch über scheinbar „moderne“ Phänomene wie die missionarische Außenpolitik von Demokratien – das gibt es nicht erst seit den Vereinigten Staaten, das perikleische Athen hatte diese Neigung auch. Ebenso mag sich am Familienleben vielerlei wandeln, nicht aber die Dauer der Kindheit und die fundamentalen Bedürfnisse von Kindern; sie werden auch in Zukunft drei Jahrzehnte brauchen, bis sie auf eigenen Füßen stehen, und sie werden weiterhin Zeit und Zuwendung in einem Maße benötigen, das Zumutungen und Einschränkungen für jede Erwachsenenwelt mit sich bringt, ob nun modern oder unmodern. Auch hier ist es wieder wie mit Schule oder Staat: Es kommt auf die Besonderheit der verschiedenen Lebenskreise an und darauf, ihnen zu ihrem Recht zu verhelfen, statt sie alle in ein Modernisierungsschema zu pressen.
Nicht Neugier, Wirklichkeitslust, Fantasie, sondern: Weiter so
Natürlich ist die Karriere des Modernisierungsglaubens kein Zufall und nicht einfach ein Irrtum. Modernisierung hat es, so jedenfalls ihr Anspruch, mit dem Neuen zu tun, und seit den achtziger Jahren leben wir tatsächlich in einer neuen Welt. Der Eintritt in die globale Marktgesellschaft und der Untergang des Kommunismus markieren das Ende der Nachkriegsepoche, ihrer ideologischen, ihrer sozialen Selbstverständlichkeiten. Die Karten werden noch einmal gemischt, und vieles muss man jetzt mit anderen Augen sehen. Der Grundfehler der Modernisierungsdoktrin ist, dass sie ebendas nicht tut, dass sie mit dem Neuen nur scheinbar auf gutem Fuß steht, während sie in Wahrheit bloß die Linien aus der Vergangenheit in die Zukunft ausziehen will. Ihr Leitmotiv ist nicht Neugier, Wirklichkeitslust, Fantasie, sondern letztlich das Weiter-so: Wir sind schon modern, wir müssen noch moderner werden.
Genau so aber kommt man in Krisen nicht durch. Ein bedeutender Physiker hat einmal bemerkt, dass es zu jedem ungelösten wissenschaftlichen Problem eine allgemein akzeptierte Theorie darüber gibt, wo die Lösung in etwa zu finden und wie sie zu suchen sei. Diese herrschende Theorie ist immer falsch, denn wäre sie richtig, so wäre das Problem längst gelöst. Eine solche Theorie unserer Gesellschaft ist die Modernisierungsideologie.
Aus: DIE ZEIT, 54. Jahrgang, Nr. 29 (15.7.1999), S. 3.
Hier finden Sie den Text als PDF zum Downloaden und Ausdrucken.